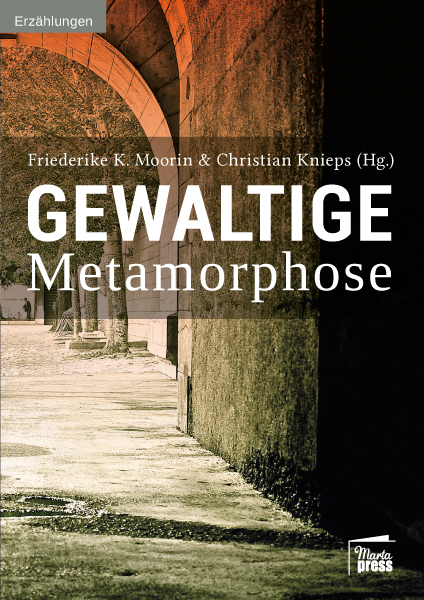Dieser Text ist als Erstveröffentlichung in dieser Anthologie erschienen:
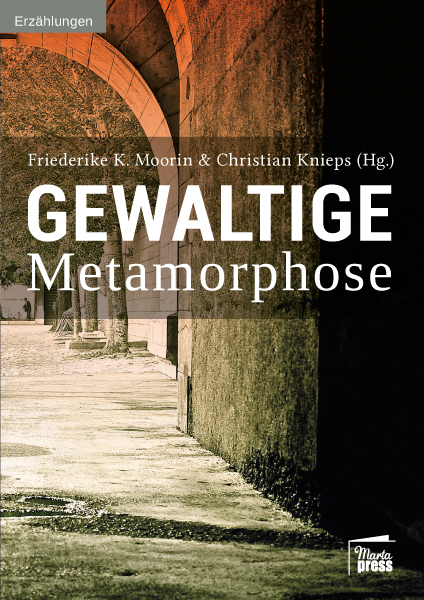
Friederike K. Moorin, Christian Knieps (Hg.): Gewaltige Metamorphose. Wir brauchen konstruktive Erzählungen
Marta Press, Hamburg, Oktober 2015
ISBN: 978-3-944442-33-4
Taschenbuch, 248 Seiten
Preis:
€ (D): 19,90
€ (A): 20,90
CHF UVP (CH): 27,90
Der Zirkustiger, der nie einer war
Ich liege auf dem Boden. Auf einer großen zusammengeknüllten Baumwolldecke. Vor mir ein Stück rohes Fleisch. Sie nennen mich Baltasar. Bin die Hauptattraktion hier, übrigens. Baltasar der „furchteinflößende“ Zirkustiger. Der Käfig ist etwas größer als ich selbst, die Stäbe fünf Zentimeter dick. Ich kann aber im Kreis gehen. Wie gnädig von meinen Besitzern.
Mittlerweile hat mein Fell an Glanz verloren, es ist, um ehrlich zu sein, recht strohig geworden und so muskulös wie in den alten Tagen bin ich auch nicht mehr, eher ein wenig dürr. Bin halt schon etwas länger hier.
Früher, als sie mich noch „zähmten“, so nennt man es hier ja – in Wirklichkeit brachen sie meinen Willen durch Erniedrigungen und Schläge – war es natürlich am schlimmsten. Heutzutage bin ich klug genug die albernen Kunststücke, die von mir verlangt werden, einfach zu tun. Es war ein Reifeprozess. Eine Abtrennung meines Inneren von den äußeren Umständen. Eine Trennung, die ich allmählich herbeiführte. Außen bin ich der „ungeheuerliche“ Baltasar mit diesen lächerlichen Zirkusauftritten in der Manege. Und jedes Mal wenn der „mutige“ Dompteur seinen Schädel in meinen weit aufgerissenen Rachen hält, bräuchte ich nur den Kiefer zuklappen lassen. Aber ich weiß was ich zu erwarten hätte. Innen, in meinem Herzen, bin ich Tiger, das natürliche Tier als das ich in Wirklichkeit geboren wurde. Da ich so meine Würde durch die Jahre innerlich wiederfand, meinen Willen, ist es erträglicher geworden. Und doch warte ich zu einer Hälfte einfach nur auf meine Erlösung, auf meinen Tod.
Heute ist der „große Tag“. Abendvorstellung in der Hauptstadt. Hunderte Besucher erwarten meine Besitzer zu diesem, wie es auf den Plakaten heißt, „sensationellen Spaß für alle“. Für alle außer für meine Mitinsassen und mich. Für uns, die Elefanten, Affen, Zebras und den ganzen Rest unserer kleinen Wohngemeinschaft.
Was normalerweise meine Beute wäre, erhält hier, im Käfigstall, nur mein mattes Mitgefühl.
Wenn wir uns in die müden Augen blicken gibt es keine natürliche Nahrungskette, keine Hierarchie. Nur Leidensgenossen, die man seit langer Zeit kennt. Trübe Abgeklärtheit.
Ich höre Schritte. Ein Zebra senkt den Blick gen Boden. Die Affen werden nervös. Immer das selbe Spiel. Es scheint gleich loszugehen.
Ein paar Zirkusangestellte holen die ersten Tiere aus ihren Käfigen, damit sie ihre Show absolvieren. In ungefähr zwei Stunden bin ich an der Reihe. Der Höhepunkt des Abends, wie die Plakatwerbung verspricht.
Es riecht jetzt nach Urin und Angst aus den umliegenden Käfigen. Man hört die Festmusik, klatschen, raunen, lachen und die harschen Befehle der Dompteure.
Ich wandere in meinem Käfig auf und ab. Jedes Mal vor meiner Nummer. Es ist der Stress, die unangenehmen, teils schmerzvollen Aufgaben. Die Bloßstellungen wider unserer Natur. Die Furcht vor diesen Dingen wird man selbst nach Jahren nicht los.
Mein Pfleger kommt und holt mich. Er versucht mich mit seinen Blicken einzuschüchtern. Ich mime Unterwürfigkeit.
Er führt mich zum Eingang der Manege und gibt mir das Signal hineinzugehen. Als ich in das Rampenlicht trete, in dem der Dompteur auf mich wartet, beginnt das Publikum zu jubeln. Manche stehen auf und applaudieren.
Der Dompteur gibt mir mit einer Bewegung seiner Peitsche den Befehl mich auf ein kleines Podest zu stellen und zu fauchen. Ich gehorche. Ich soll mich auf die Hinterbeine stellen. Durch einen Ring springen. Und noch viele weitere Kinkerlitzchen.
Dann muss ich einmal im Halbkreis an der Absperrung zum Publikum entlang laufen. Das Programm variiert so gut wie nie. Doch plötzlich sehe ich, dass eines der Gatter einen Spalt offen steht, der klein genug war, um in dem ganzen Trubel nicht bemerkt zu werden. Wie ein feuriger Blitz schießt es durch mein Herz. Eine unaussprechliche Sehnsucht erfasst mich. Ich lasse mir meine Entdeckung nicht anmerken und höre auf das Signal zurück zum Podest zu gehen.
Der Höhepunkt der Show beginnt jetzt. Ich muss mein Maul weit aufsperren, so dass der Dompteur seinen Kopf zwischen meine Zähne halten kann. Um die Spannung zu erhöhen signalisiert er dem Publikum nun ganz still zu sein und man hört nur noch leises Tuscheln. Ich öffne mein Maul nach einem kleinen Wink des Dompteurs mit seiner Hand und er beugt sich vorne über, den Kopf zur Seite, Richtung Publikum gedreht, um ihn dann langsam in mein geöffnetes Maul zu stecken.
Doch plötzlich, sein Haupt zwischen meinen Zähnen, sieht er das offene Gatter.
Ich merke, als würde alles außerhalb der Zeit geschehen, dass er kurz zögert, und danach seinen Kopf herausziehen will um Alarm zu schlagen. Wie in Trance lasse ich meine Zähne ein Stück zusammenfallen. Immer noch ohne den Dompteur zu berühren. Er erschrickt und versteht was ich drohe, und lässt so seinen Kopf wo er ist. Ich spüre seine verzweifelte Angst. Er denkt, wenn er jetzt den anderen zu verstehen gibt was los ist oder versucht seinen Kopf herauszuziehen, lasse ich meine Kiefer zuschnellen. Er weiß, dass er geschlagen ist. Und er weiß, dass sich etwas in mir verändert hat. Dass seine überhebliche Sicherheit von jetzt an nicht mehr gewährt ist.
Langsam bewege ich mich rückwärts und gebe seinen Kopf frei, steige von dem Podest und gehe in Richtung der rot bemalten Absperrung, die rund um die Manege aufgebaut ist. Die Zeit ist jetzt auf meiner Seite, denn bevor den Leuten und dem Zirkuspersonal bewusst wird was hier passiert, und die anschließenden Schocksekunden überwunden sind, bin ich schon nahe dem Gatter. Nun bricht Panik aus. Leute versuchen zu den Ausgängen zu gelangen. Manche rennen, manche stehen einfach wie betäubt da. Mein Weg ist wie leergeräumt, schließlich strömen alle von mir weg. Schreien, kreischen. Ich tue euch nichts, keine Angst. Ich werde nur wieder Herr über mein Leben. Nicht über eures. Die Zirkusleute brüllen sich aufgeregt Anweisungen zu. Man solle die Gewehre holen, mich endlich abknallen. Dann verlasse ich durch das offene Gatter und den dahinter liegenden Ausgang das Zirkuszelt. Ich beginne zu rennen, bald zu sprinten. Polizeisirenen ertönen in der Ferne.
An einem Fluss auf einer kleinen Wiese angekommen, geschützt von zwei Bäumen, lege ich mich hin. Ich schließe meine Augen.
Sehe meine Eltern in der strahlenden Sonne der Savanne und meine Brüder und Schwestern wie sie auf dem staubigen Boden herumtollen. Sehe wie es früher einmal war. Mein Herz schlägt endlich wieder. Ich habe mein Leben zurückerobert. Bin wieder Tiger. Ich höre mittlerweile wie die Verfolger nach mir rufen. Die Zirkusleute, Polizisten, Feuerwehrleute. Wie sie Baltasar schreien und immer näher kommen. Erste Schüsse fallen. Zwei schlagen neben mir in den Boden. Weitere surren an mir vorbei durch die Luft. Ich halte meine Augen geschlossen, bleibe in der Heimat, in der Savanne. Ich bin nicht mehr Baltasar. Ich war es nie.